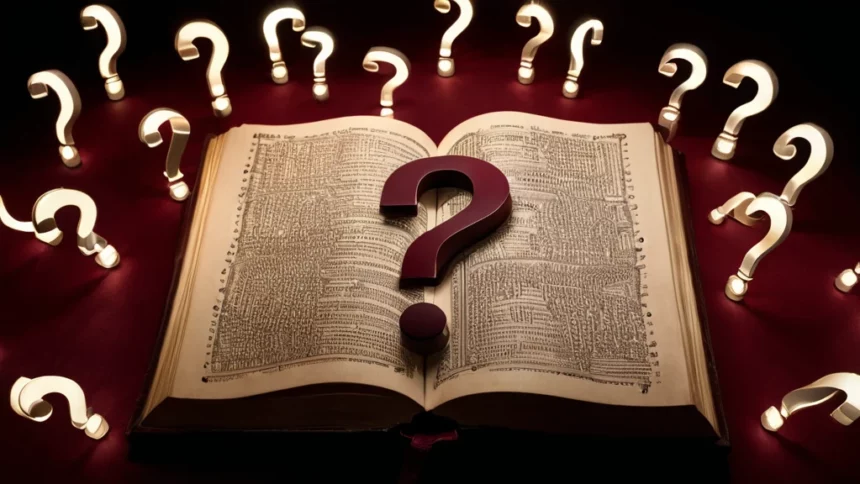Glossar: Scherbengericht
Bedeutung
Das Wort Scherbengericht bezeichnet ein antikes Verfahren der direkten Demokratie, das in Athen praktiziert wurde. Es handelt sich um eine Abstimmungsmethode, bei der Bürger auf Tonscherben den Namen einer Person schreiben konnten, die sie als gefährlich für die Gemeinschaft ansahen. Wurde eine bestimmte Anzahl an Stimmen erreicht, musste die Person für zehn Jahre das Land verlassen. Das Ziel war, potenzielle Tyrannen zu verhindern und die Demokratie zu schützen.
Herkunft
Der Begriff Scherbengericht stammt aus dem Altgriechischen „ostrakismos“, was sich auf die Tonscherben, die „ostraka“, bezieht. Diese wurden bei der Abstimmung verwendet. Der Prozess war ein zentraler Bestandteil der athenischen Demokratie im 5. Jahrhundert v. Chr.
Wortart
Das Wort Scherbengericht ist ein Substantiv (Neutrum) im Deutschen. Es setzt sich zusammen aus den Wörtern „Scherbe“ (Fetzen eines zerbrochenen Tongefäßes) und „Gericht“ (juristische Institution oder Verfahren).
Synonyme
Im Deutschen gibt es kaum direkte Synonyme für Scherbengericht, da es sich um einen spezifischen historischen Begriff handelt. Mögliche Umschreibungen könnten „Ostrakismos“ oder „Athenisches Exilierungsverfahren“ sein, die jedoch eher als Erklärungen denn als Synonyme dienen.
Gegenteil
Ein direktes Gegenteil zu Scherbengericht existiert nicht, da es sich um einen sehr spezifischen historischen Prozess handelt. In einem weiteren Sinn könnte man Verfahren nennen, die der Integration oder Rehabilitierung dienen, aber diese sind nicht direkt als Antonyme zu verstehen.
Beispielsätze
- Im antiken Athen war das Scherbengericht ein effektives Mittel, um die Demokratie zu schützen.
- Die Bürger nutzten das Scherbengericht, um potenzielle Tyrannen aus der Stadt zu verbannen.
- Der Begriff Scherbengericht leitet sich von den Tonscherben ab, die bei der Abstimmung verwendet wurden.
- Obwohl das Scherbengericht eine harte Maßnahme war, galt es als notwendig für den Erhalt der demokratischen Ordnung.
Insgesamt zeigt das Scherbengericht als historisches Konzept, wie sich frühe demokratische Systeme mit Bedrohungen von innen auseinandersetzten. Während moderne Demokratien andere Mechanismen nutzen, bleibt der Ostrakismos ein faszinierendes Beispiel für die kreativen Lösungen der Antike.